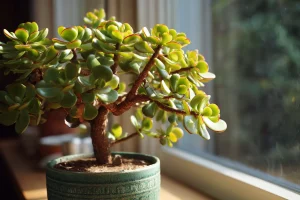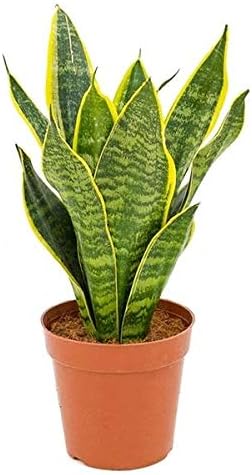Du hast dir voller Vorfreude deine ersten Lithops gegönnt – und plötzlich werden sie matschig, schrumpeln oder wirken einfach… unglücklich? Keine Sorge, du bist nicht allein. Fast jeder, der mit diesen faszinierenden „lebenden Steinen“ beginnt, stolpert am Anfang über dieselben Fallen.
Lithops sind nämlich keine „normalen“ Sukkulenten, die man nach Gefühl gießt und vergisst. Sie sind Überlebenskünstler aus den trockensten Regionen der Welt – mit einem ganz eigenen Rhythmus, speziellen Bedürfnissen und einer gehörigen Portion Eigenwilligkeit.
In diesem Artikel zeige ich dir die fünf häufigsten Anfängerfehler, wie du sie erkennst und – vor allem – wie du sie ganz leicht vermeidest. Keine komplizierte Theorie, sondern klare Tipps, die deine Lithops glücklich machen und dir viele Jahre Freude schenken.

Fehler 1: Zu viel Wasser – der schleichende Tod
Wasser ist Leben – aber für Lithops kann es schnell zum Todesurteil werden. Anders als viele andere Pflanzen speichern Lithops in ihren dicken Blättern enorme Wassermengen, um lange Trockenzeiten zu überstehen. Sobald du ihnen zu oft „etwas Gutes tun“ willst, beginnt das Drama: Die Zellen platzen, Pilze und Bakterien freuen sich – und deine Pflanze verabschiedet sich still und leise.
Typische Symptome:
- Blätter fühlen sich matschig an und wirken durchscheinend
- Blätter lösen sich plötzlich vom Wurzelhals, ohne Häutungsphase
Schnell handeln:
- Pflanze vorsichtig aus dem Topf nehmen
- Wurzeln gründlich von Erde befreien und mindestens 24 Stunden komplett trocknen lassen
- Für mindestens 4 Wochen jegliches Gießen einstellen – ja, auch wenn es schwerfällt!
So vermeidest du es:
- Gießen nur, wenn sich im Herbst oder Frühling deutliche Falten zeigen
- Fingerprobe oder Zahnstocher-Trick: Erst wässern, wenn das Substrat wirklich komplett trocken ist
- Jahreszeitlichen Gießkalender im Blick behalten
Merke: Bei Lithops ist weniger nicht nur mehr – weniger ist überlebenswichtig.
Fehler 2: Falsches Substrat – die Erstickungsfalle
Komposterde oder normale Blumenerde mögen für andere Pflanzen toll sein – für Lithops ist sie ein echter Killer. Ihre Wurzeln brauchen extrem gut durchlässiges, mineralreiches Substrat. Bleibt die Erde zu lange nass, faulen die Wurzeln schnell und die Pflanze stirbt langsam.
Typische Symptome:
- Die Erde bleibt selbst nach zwei Tagen noch staunass
- Gelbverfärbungen am Pflanzenkörper
Ideal-Substrat:
Perfekt ist eine Mischung aus:
- 80% mineralische Anteile (Bims, Lavagranulat, Perlite)
- 20% Kakteenerde
DIY-Tipp: Du kannst günstige Alternativen wie Seramis + Aquarienkies verwenden.
Umtopf-Guide:
- Nur während der Wachstumsphase umtopfen
- Sanft arbeiten, Wurzeln nicht beschädigen
- Nach dem Umtopfen 1-2 Wochen ohne Wasser lassen, damit Wunden abheilen
Merke: Lithops lieben mineralisches Substrat – je trockener und durchlässiger, desto gesünder die Pflanze.
Fehler 3: Zu wenig Licht – der Wachstums-Killer
Lithops lieben Sonne – zu wenig Licht lässt sie jämmerlich „etiolieren“: Die Pflanzen strecken sich, werden dünn, blass und blühen oft gar nicht. Ein trüber Standort kann also schnell das Ende der schönen Steine bedeuten.
Typische Symptome:
- Verlängerte, dünne Blätter („Spargel-Lithops“)
- Keine Blüten während der Wachstumsphase
Lösungen:
- Natürlicher Standort: Südfenster mit mindestens 5 Stunden direkter Sonne täglich
- Kunstlicht: LED-Pflanzenlampen, speziell für Sukkulenten geeignet
Achtung Akklimatisierung:
Neue Pflanzen dürfen nicht sofort in pralle Sonne gesetzt werden. Gewöhne sie Schritt für Schritt an intensives Licht, damit keine Sonnenbrand-Schäden entstehen.
Merke: Lichtmangel lässt Lithops schwach werden – genügend Sonne ist das A und O für gesunde, blühfreudige Pflanzen.
Fehler 4: Störung der Häutungsphase
Lithops durchlaufen jedes Jahr eine Häutungsphase, in der sie ihre alten Blätter „fressen“ und neue bilden. Eingriffe während dieser Zeit rauben der Pflanze wertvolle Energie und können dauerhafte Schäden verursachen.
Typische Symptome:
- Künstliches Abziehen alter Blätter → Narben oder Deformierungen
- Gießen während der Häutung (Jan–Apr) → neue Blätter können aufplatzen
Richtiges Handling:
- Während der Häutungsphase absolut trocken halten
- Alte Blätter selbst abfallen lassen – nicht abziehen
- Nur minimal bewegen oder berühren, um Stress zu vermeiden
Merke: Geduld ist in dieser Phase entscheidend – je weniger du eingreifst, desto gesünder die neuen Blätter.
Fehler 5: Ungeeignete Nachbarn
Lithops haben spezielle Wasser- und Lichtbedürfnisse, die oft nicht mit anderen Sukkulenten übereinstimmen. Werden sie zusammen mit Pflanzen wie Echeverien gesetzt, endet das oft in einem feuchten Desaster oder unterentwickelten Pflanzen.
Typische Probleme:
- Überwässerung durch andere Pflanzen
- Ungleiche Licht- und Wachstumszyklen
Lösungen:
- Reine Lithops-Töpfe – so bestimmst du selbst die Pflege
- Kompatible Partner: Conophytum, Pleiospilos – ähnliche Wachstumszyklen
Arrangement-Tipps:
- Minilandschaften mit mineralischem Mulch wie Quarzsand
- Abstand zwischen Pflanzen einhalten, um Luftzirkulation zu sichern
Merke: Nicht alle Sukkulenten vertragen sich – die richtigen Nachbarn sind entscheidend für gesunde Lithops.
Bonus: Lithops-Checkliste für Anfänger
Diese Checkliste fasst alle wichtigen Punkte zusammen, damit du deine Lithops optimal pflegen kannst. Perfekt zum Ausdrucken und Abhaken!
- Substrat: Verwende mindestens 80% mineralische Bestandteile wie Bims, Lavagranulat oder Perlite.
Nur so bleibt die Erde durchlässig und die Wurzeln faulen nicht. Eine kleine Menge Kakteenerde (max. 20%) ist erlaubt. - Topf: Wähle einen Topf nicht tiefer als 5–7 cm und achte unbedingt auf ein Drainageloch.
Lithops haben flache Wurzeln und zu viel Erde hält die Feuchtigkeit zu lange – das kann tödlich sein. - Gießen: Gieße nur, wenn die Blätter deutliche Falten zeigen – im Herbst (Oktober–November) und im Frühjahr (Mai–Juni).
Prüfe die Erde vorher mit Fingerprobe oder Zahnstocher. Zu viel Wasser führt sehr schnell zu Fäulnis. - Häutung: Zwischen Januar und April befinden sich Lithops in der Häutungsphase.
Während dieser Zeit kein Wasser geben! Lass die alten Blätter selbst abfallen, greife nicht ein. - Standort: Südfenster oder geeignete LED-Wachstumslampe mit mindestens 5 Stunden direktem Licht pro Tag.
Neue Pflanzen langsam an intensive Sonne gewöhnen, um Sonnenbrand zu vermeiden. - Nachbarn: Pflanze Lithops nur mit kompatiblen Partnern wie Conophytum oder Pleiospilos,
die ähnliche Wasser- und Lichtbedürfnisse haben. So verhinderst du ungleiche Pflegezyklen und Krankheiten. - Umtopfzeitpunkt: Nur während der Wachstumsphase umtopfen.
Danach 1–2 Wochen ohne Wasser lassen, damit eventuelle Wurzelschäden abheilen können.
Tipp: Drucke die Liste aus, hake jeden Punkt ab und behalte so deine Lithops immer optimal im Blick! Hier kannst Du die Lithops Checkliste runterladen: Lithops Checkliste (PDF)
Fazit: Weniger ist mehr
Jeder Fehler, den du mit deinen Lithops machst, bringt dich ein Stück näher zum perfekten Pflanzenelternteil.
Mit der richtigen Pflege, dem passenden Substrat, genügend Licht und Geduld während der Häutungsphase stehen die Chancen gut, dass deine „lebenden Steine“ gesund wachsen und wunderschön blühen.
Also: Keine Panik, lieber einmal zu wenig als zu viel eingreifen – deine Lithops danken es dir!